12.03.2021
Photovoltaik: Rekordjahr 2020 in der Schweiz

Foto: Eternit Schweiz AG / www.meraner-hauser.com
In der Schweiz sind 2020 nach Einsachätzung von Swissolar so viele Solarstromanlagen zugebaut worden wie noch nie. Um die nationalen Energieziele zu erreichen, ist aber das vierfache Volumen nötig.
Für die Photovoltaik war 2020 in der Schweiz ein Rekordjahr. Davon geht Swissolar aus, der Schweizerische Fachverband für Sonnenenergie. Aufgrund von bereits verfügbaren Zahlen rechnet der Verband mit Neuinstallationen von 430 bis 460 Megawatt (MW). Dies entspricht einem Wachstum von 30 bis 39 Prozent gegenüber 2019. Die Anmeldezahlen bei der Zertifizierungs- und Förderstelle Pronovo lassen darauf schliessen, dass das Wachstum nicht nur bei kleinen Anlagen, sondern auch bei solchen über 100 kW Leistung stattfand. Die offizielle Statistik für den Solarenergie-Zubau im Jahr 2020 wird im Juli 2021 vorliegen.
Für das starke Marktwachstum ist insbesondere die Verkürzung der Wartefrist bei der Einmalvergütung auf wenige Monate verantwortlich. Die 2019 stärker ins Zentrum gerückte Klimakrise hat zudem vermutlich bei einigen Bauvorhaben eine Solar-Integration vorangetrieben. Auch Corona hatte wohl einen Einfluss auf den Solarzubau. Der Wunsch nach Autarkie nahm zu, viele fanden Zeit, um lange gehegte Ideen zu realisieren und finanziell stand mangels anderer Ausgabemöglichkeiten mehr Kapital zur Verfügung. Ob diese Effekte im laufenden Jahr weiterhin wirksam sind, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.
Schweiz braucht vierfaches Volumen
Der Rekordzubau dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Zubau noch einer massiven Steigerung bedürfe. Pro Kopf entspricht der Zubau 2020 lediglich einer neu installierten Fläche von 0.25-0.27 Quadratmetern. «Um den wegfallenden Atomstrom zu ersetzen und den zusätzlichen Strombedarf für die Elektrifizierung des Verkehrs und der Heizungen zu decken, muss der jährliche Zubau in den nächsten Jahren auf etwa 1500 MW gesteigert werden – also auf das nahezu Vierfache des letzten Jahres» sagt Swissolar-Geschäftsleiter David Stickelberger. Dies sehen auch die kürzlich veröffentlichten Energieperspektiven 2050+ des Bundesamtes für Energie vor.
Zur Erreichung dieses Ziels braucht es aus Sicht der Schweizer Solarbranche folgende politische Massnahmen:
a) Stärkere Förderung von Anlagen ohne Eigenverbrauch: Zahllose Dächer von Ställen, Lagerhäusern und ähnlichen Gebäuden werden heute nicht mit Solaranlagen ausgestattet, da der Strom nicht an Ort und Stelle verbraucht werden kann. Ähnliches gilt für Parkplatzüberdachungen, Lärmschutzwände und weitere Infrastrukturen.
b) Rasche Umsetzung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) in allen Kantonen und damit verbunden die Pflicht zur Eigenstromerzeugung bei Neubauten. In einem weiteren Schritt ist eine Verpflichtung zur Nutzung bestehender Dach- und Fassadenflächen zu prüfen.
c) Abbau von Hürden bei der Erstellung von Freiflächenanlagen: Eine kürzlich veröffentlichte Studie der ZHAW zeigt auf, dass Solaranlagen ausserhalb von Gebäuden nur mit Schwierigkeiten eine Baubewilligung erhalten. Davon betroffen sind sinnvolle Nutzungen wie Parkplatzüberdachungen, Systeme zum Schutz empfindlicher landwirtschaftlicher Kulturen anstelle von Folientunnels (Agro-Photovoltaik) oder alpine Anlagen im Umfeld von Skigebieten.
Quelle: www.solarserver.de
Alle News →Ähnliche Beiträge
-
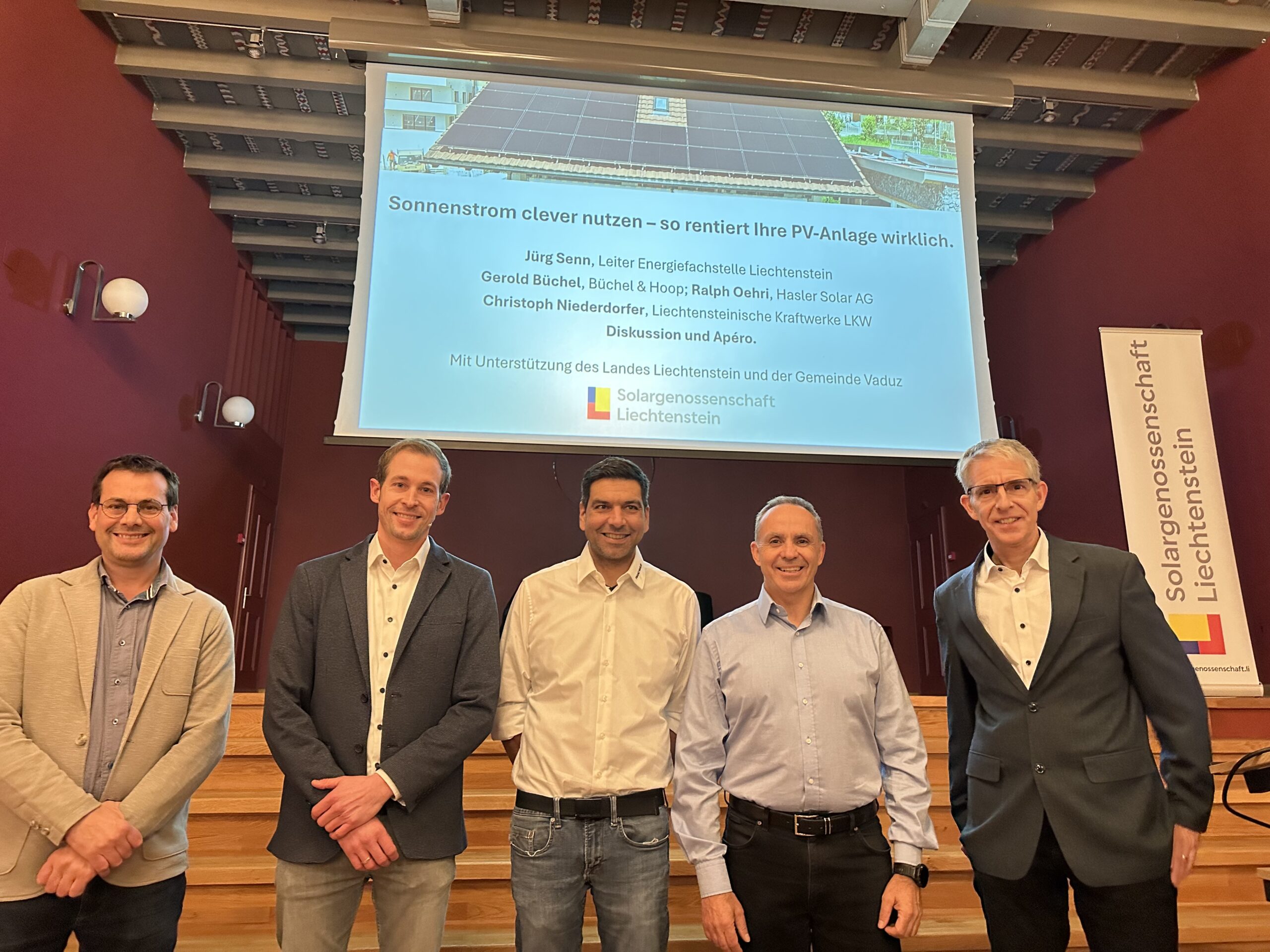
Riesiges Interesse an rentabler Photovoltaik
Die Bevölkerung strömte in Scharen zum Vortragsabend der Solargenossenschaft zum Thema «Sonnenstrom rentabel nutzen». Die vorbereiteten Stühle im Rathaussaal reichten nicht aus, Reihe um Reihe musste dazugestellt werden, am Schluss mussten doch noch einige der rund 170 Besucherinnen und Besucher stehen. PV wird angemessen gefördert Die ersten interessanten Einblicke in die rentable Nutzung der Photovoltaik […]
-

25 Jahre Sonnenkraft auf der Rheinbrücke Bendern-Haag
Mit dem Bau der Photovoltaikanlage auf der Rheinbrücke Bendern–Haag setzte die Solargenossenschaft vor 25 Jahren ein Zeichen für den Aufbruch in eine nachhaltigere Energiezukunft. Die PV-Anlage gehörte zu den ersten grossflächigen Solarinstallationen im Alpenrheintal. Sie nahm ihren Betrieb 2000 auf, das grosse Einweihungsfest mit mehreren hundert Personen fand am 1. Juli 2001 statt. Wegen der […]
-

Österreich auf dem Weg zur Energie-Wende: 94 % Strom aus erneuerbaren-Quellen
Im Jahr 2024 stammte in Österreich bereits 94 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen – ein deutlicher Erfolg für die Energiewende. So ergibt es sich aus dem aktuellen Monitoringbericht des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), den die Regulierungsbehörde E-Control vorstellte. Laut Angaben von E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch sei durch die Neugestaltung der Fördermechanismen – weg von fixen Einspeisetarifen hin […]
-

Vortragsabend der Solargenossenschaft: So rentiert Ihre PV-Anlage wirklich
Zur LieWo-Vorschau auf diesen Anlass (LieWo 7.12.25, S. 20). Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, um 19 Uhr, lädt die Solargenossenschaft in den Rathaussaal Vaduz zu einem öffentlichen Vortragsabend ein. Unter dem Titel «Sonnenstrom clever nutzen – so rentiert Ihre PV-Anlage wirklich» erhalten Hauseigentümerinnen, Unternehmen und Energieinteressierte einen kompakten Überblick über die wichtigsten Faktoren, die heute […]
Alle Videos und Präsentationen des Vortragsabends online: «So rentiert Ihre PV-Anlage»
PV-Anlagen können in Liechtenstein nach wie vor rentabel betrieben werden – man muss nur wissen, wie. Im Dezember haben ausgewiesene Fachleute bei der Solargenossenschaft darüber referiert. Die Referate (Videos und Präsentationen) sind jetzt online.